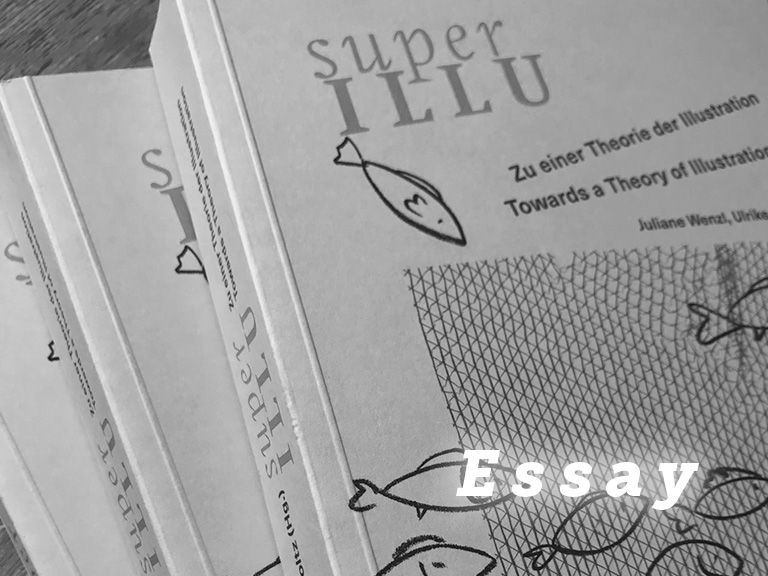Last Updated on 12/11/2024
Sehen lernen: Die Herausforderung der Repräsentation (I)
Im ersten Teil dieses Aufsatzes geht es um die für die Künste bzw. Medien typische Beschränkung auf jeweils nur eine oder zwei Sinnesmodalitäten und den damit verbundenen Konsequenzen für die Repräsentation der äußeren Wirklichkeit. Ausführlich werden Leonardo da Vincis Argumente für die Vorzüge der Malerei gegenüber der Poesie und Bildhauerei vorgestellt, die er in seinem berühmten Traktat von der Malerei formuliert. Der zweite, in einem eigenen Artikel veröffentlichte Teil befasst sich mit der Rolle der Imagination und Virtual Reality.
Raum und Zeit gehören zu den grundlegenden Daseinsbedingungen des Menschen; wir befinden uns immer irgendwo und immer nur an einem Ort zur selben Zeit, zumindest was unsere physische Präsenz angeht. Die physikalische Beschreibung der Welt unterscheidet drei Raumdimensionen und eine Zeitdimension. Durch den Raum können wir uns bewegen, nicht aber durch die Zeit; eher könnte man davon sprechen, dass die Zeit durch uns hindurchgeht. Und im Unterschied zum Raum, den wir optisch, akustisch, olfaktorisch und haptisch sowie durch unser allgemeines Körpergefühl (Propriozeption) wahrnehmen, wird uns die Erfahrung der Zeit nicht durch ein eigenes Sinnesorgan vermittelt.
Dennoch können wir zeitliche Abläufe durch aufeinanderfolgende Ereignisse in unserer Umgebung wahrnehmen. Das können eine Abfolge von Klängen, die Bewegungen von Lebewesen und Dingen oder andere Veränderungen, beispielsweise der Stand der Sonne im Laufe eines Tages oder der Verlauf der Jahreszeiten u.v.m. sein. Und wir haben ein Gefühl für die Dauer von Ereignissen, können unterscheiden, ob etwas kurz oder lang währt, das Spektrum reicht von der Kürze eines Augenblicks bis zu vielen Jahren, wobei die Erinnerung eine wichtige Rolle spielt.
Unter den für das Zeitgefühl elementar wichtigen Ereignissen sind unsere eigenen Handlungen hervorzuheben, die wir, anders als die meisten äußeren Ereignisse, kontrollieren können. Jeder hat die Erfahrung gemacht, dass die Zeit, wenn man konzentriert bei einer Sache ist, wie im Flug zu vergehen scheint, während sie sich bei anderer Gelegenheit, wenn wir beispielsweise auf etwas warten, zu dehnen scheint und wir unter dem Gefühl quälender Langeweile leiden. Die Psychologie der Dauer spielt im Leben eine bedeutende Rolle, denn die gelebte Zeit unterscheidet sich stark von der gemessenen. Wie jeder weiß, unterteilt eine Uhr die Zeit, unabhängig von individuellen Erlebnissen, in gleichmäßige Abschnitte.
Außerdem verfügt der Mensch, ebenso wie andere Lebewesen, über eine sogenannte ›innere Uhr‹ – Besitzer von Hunden oder Katzen wissen, dass diese sich pünktlich zur üblichen Zeit am Fressnapf einfinden oder erwartungsvoll an der Haustür sitzen, wenn der nächste Spaziergang ansteht. Die innere Uhr ist nicht an den Wachzustand, also nicht an aktuelle Wahrnehmung gebunden, sie holt uns beispielsweise auch recht zuverlässig im richtigen Moment aus dem Schlaf.
Zweidimensionalität als kultureller Faktor
Zu den Besonderheiten der visuellen Kommunikation gehört es, dass ihre Werke zweidimensional sind, sie erscheinen auf der Oberfläche von Informationsträgern wie Papier oder Bildschirm; neben dem Visuellen haben sie auch dies mit dem klassischen Tafelbild der Malerei gemeinsam, man kann sie daher einfach zu den Bildwerken zählen. Die materielle Unterlage, der Bildträger, befindet sich zwangsläufig irgendwo im dreidimensionalen Raum, und sofern es sich nicht um Wandbilder, Plakate, installierte Displays o.ä. handelt, ist dessen Position nicht festgelegt. Mobile Bildträger wie Bücher, Magazine, Flyer, Smartphones, Tablet-Geräte u.a.m. bieten aufgrund der leichten Transportierbarkeit einige Vorteile hinsichtlich der Kommunikation und sind u. a. deswegen auch besonders beliebt.
Zweidimensionalität – als eine Erfahrung, nicht als mathematisches Konzept – ist eine Entdeckung, die niemandes Namen trägt, die aber wohl zu den folgenreichsten Ereignissen der Menschheit zählt: Kultur basiert zu einem wesentlichen Teil auf Zweidimensionalität. Angefangen bei Höhlenmalereien über ägyptische Wandbilder, Schrifttafeln, Fresken, Papyrus und Pergament (Tierhaut) bis hin zu auf Papier gedruckten Büchern und schließlich elektronischen Displays hat sich die Zahl zweidimensionaler Botschaften im Laufe der Jahrtausende ins Unermessliche vermehrt und ihre materielle Grundlage ebenso stark verändert. Die Entdeckung der Zweidimensionalität war – falls man überhaupt von einer Entdeckung im üblichen Sinne sprechen kann – ein intuitiver Vorgang, denn in der Wahrnehmung sind beide, Zwei- und Dreidimensionalität, miteinander verschränkt. Der Vollständigkeit halber muss man auch die Eindimensionalität hier mit einbeziehen. Auch das Eindimensionale ist uns seit jeher in Gestalt des Horizonts vertraut. Die dreidimensionale Welt schließt die Ein- und Zweidimensionalität ein, ohne dass sie darin aufgehen würden.
Es ist für uns selbstverständlich, sowohl die Dreidimensionalität der Körper wie auch die Zweidimensionalität ihrer Oberfläche wahrzunehmen. Außerdem orientiert sich unsere Lebensweise hauptsächlich an der Ausdehnung von Länge und Breite, während die Höhe, obwohl stets präsent, für uns, anders als bei flugfähigen Lebewesen oder den Tieren des Meeres, nur eine geringe Rolle spielt, da wir ohne Hilfsmittel kaum über die Grenzen des eigenen Körpers hinauskommen. Die Freiheitserfahrung in der Höhe ist gegenüber Länge und Breite doch stark eingeschränkt. Für eine Höhenerfahrung, die in nennenwertem Maß über den Körper hinausgeht, bedarf es irgendeiner Stütze: wir müssen auf einen Baum oder Berg klettern oder mit dem Aufzug zur Aussichtsplattform eines hohen Gebäudes fahren. Aber auch dann haben wir uns nicht von der Oberfläche gelöst. Selbst die Überwindung der Schwerkraft mit moderner Technik hat nichts daran geändert, dass wir im Wesentlichen mit den Füßen auf dem Boden stehen und die Welt aus dieser Perspektive wahrnehmen. Sich gehend fortzubewegen ist vielleicht die ursprünglichste Erfahrung der Zweidimensionalität, der Traum vom Fliegen der stärkste Ausdruck unseres Wunsches, den Raum vollständig zu beherrschen.
Auch die Reduktion der plastischen Körper in die zweidimensionale Fläche hat für uns nichts Befremdliches. Denn das Sehen als physikalisch-physiologischer Vorgang beginnt mit der Projektion der Außenwelt auf die Netzhaut, wo sie als zweidimensionales Bild erscheint. »Exstirpiert man ein menschliches oder tierisches Auge«, schreibt der Kunstpsychologe Rudolf Arnheim, »so kann man auf dem Augenhintergrund ein kleines, aber vollständiges und getreues Abbild der Außenwelt sehen, auf die das Auge gerichtet ist.«1 Und obwohl wir uns der zweidimensionalen Projektion nicht ständig bewusst sind, steht sie doch für bestimmte Tätigkeiten zur Verfügung, vor allem nämlich für das Bildermachen: Bei der korrekten perspektivischen Darstellung eines Gegenstandes kommt es darauf an, diesen in die zweidimensionale Fläche zu projizieren, m. a. W. dessen Netzhautbild zu zeichnen. Jedem ist es mit ein wenig Anstrengung möglich, beispielsweise die Flächen eines Würfels nicht als perspektivisch verzerrte Quadrate zu sehen, sondern als Trapezformen. Realistische Maler oder Zeichner sind in besonderer Weise befähigt, ihr Netzhautbild zu sehen und darzustellen.
Darüber hinaus belegen die Zeichnungen von Kindern, dass die Welt im Bild zunächst zweidimensional und in stark vereinfachten Formen beginnt, wenn etwa ein Kopf als Oval gezeichnet wird. Arnheim nennt die Reduktion auf einfache Formen Darstellungsbegriffe (Arnheim 1977, S. 158 ff.), da sie, ähnlich wie sprachliche Begriffe, Verallgemeinerungen darstellen, also von den mehr oder weniger zufälligen Einzelheiten der wahrgenommenen Objekte abstrahieren. Der visuelle Begriff enthält nur wenige Details, stattdessen zeigt er das zugrundeliegende Schema. Ganz ähnlich ließe sich von der Erde, dem Boden, auf dem wir stehen, ungeachtet seiner zahllosen kleineren Furchen und Erhebungen behaupten, er sei zweidimensional. Die Mathematik erklärt uns, dass zweidimensionale Flächen auch gekrümmt sein können, etwa die Oberfläche einer Kugel oder eines Zylinders.
Das Bildermachen gehört zur Menschwerdung wie die Sprache – der Philosoph Hans Jonas sprach vom Homo Pictor2, dem bildbegabten Mensch – und den unbekannten Künstlern, die sich vor Jahrtausenden daran machten, Höhlenwände mit Tierdarstellungen und Jagdszenen zu bemalen, ist ihre Arbeit, so darf man vermuten, nicht sonderlich schwergefallen. Es ist anzunehmen, dass sie über ein gewisses Talent verfügten. Der Menschen ist der Zweidimensionalität deswegen so sehr zugeneigt, weil sie sich für die symbolische Welt (Schrift, Bild etc.) als besonders geeignet herausgestellt hat.
Die Einseitigkeit der künstlerischen Medien
Schieben wir den enormen Erfolg der Zweidimensionalität einmal beiseite und nehmen stattdessen an, dass in der zweidimensionalen Reduktion, weil sie dem Wahrnehmungserlebnis so grundlegend zu widersprechen scheint, ein Mangel liegt, der ein erhebliches Hindernis für die Repräsentationsfähigkeit der dreidimensionalen Wirklichkeit bedeutet. Hinzu kommt – und auch das widerspricht dem Wahrnehmungserlebnis ganz grundlegend –, dass das Bild stillsteht, es fehlt ihm die zeitliche Dimension. Anders gesagt, das Bild ist nicht lebendig. Dieser Wunsch, dieses Begehren, das Bild möge leben, zieht sich durch die gesamte abendländische Bildgeschichte. Es äußert sich beispielsweise im lobenden Urteil über eine Darstellung, sie sei eben aufgrund des Eindrucks der Lebendigkeit besonders gelungen. Und wie die nebenstehende Fotografie zeigt, wurde in den Anfangstagen des Kinos sehr deutlich wahrgenommen, wie erst durch den Film die Bilder wirklich lebendig werden. Wenn der Film als zeitbasiertes Medium ideal für jede Form von Erzählung ist, muss wohl umgekehrt gelten, dass ohne zeitliche Dimension der Versuch, irgendeine Art von Bewegung, von Ablauf, Veränderung oder Handlung im Bild darzustellen, zum aussichtslosen Unterfangen wird. Die konsequente Schluss lautet: Bilder erzählen nichts. Wir wissen, dass dies, zumindest in dieser Ausschließlichkeit, nicht stimmt. Davon wird an anderer Stelle noch die Rede sein, im Moment genügt die Feststellung, dass dem Bild mehr als nur die dritte Dimension fehlt.
Dass ein mit so gravierenden Mängeln behaftetes Medium derart erfolgreich werden konnte, dafür müssen Gründe vorliegen, die schwerer wiegen als die hier angenommenen Nachteile. Aber das zweidimensionale Bild ist ja nicht das einzige künstlerische Medium oder Ausdrucksmedium. In der plastischen Gestaltung, die bereits in den frühen Hochkulturen und erst recht im antiken Griechenland und Rom zur Höchstform sich entfaltete, konnte der Mangel an räumlicher Tiefe erfolgreich überwunden werden, oder besser gesagt: er spielte dort nie eine Rolle, es gehört eben zum Wesen des Mediums plastisch dreidimensional zu sein.
Doch nur mit bewegten Körpern oder Objekten lassen sich zeitliche Abläufe realisieren. Bedeutet dies nicht, dass mit dem Tanz oder dem Theater erst die idealen künstlerischen Voraussetzungen gegeben sind? Nun hat man damit aber den Bereich dessen verlassen, was üblicherweise unter einem Bild verstanden wird; bei dem Versuch, dessen vorgebliche Mängel zu beseitigen, sind wir wieder in der Komplexität und Unhandlichkeit der äußeren Wirklichkeit gelandet. Denn Tanz bedeutet ja in der Regel, dass sich reale Menschen im realen Raum bewegen; es sind völlig andere Mittel, derer sich der Tanz im Vergleich mit dem Bild bedient, um etwas zum Ausdruck zu bringen oder zu repräsentieren.
Damit verbunden ist ein ungleich höherer materieller Aufwand sowie eine räumliche und zeitliche Abhängigkeit, die die Rezeption, Verbreitung und Reproduktion eines Werks erheblich erschweren: das Publikum muss sich zu gegebener Zeit am gegebenen Ort einfinden, um einer im Moment der Aufführung einmaligen Darbietung in realer Größe beizuwohnen. Von einer zweiten bzw. jeder weiteren Aufführung kann man nicht sagen, es handele sich um die Reproduktion der ersten. Mit den Mängeln sind zugleich alle Vorzüge des Bildes verschwunden: vor allem dessen Zweidimensionalität – die folglich gar kein Mangel ist, weil dadurch erst die Voraussetzungen für leicht reproduzierbare, kleine und mobile Formate gegeben sind – sowie die Reduktion auf einfache Formen, die Anschauungsbegriffe, wie Arnheim sie nennt.
Sollte die äußere Wirklichkeit nicht der geeignete Maßstab zur Beurteilung sein? Dem widerspricht, dass diese in all ihren Erscheinungen Gegenstand von Kunst und Gestaltung ist – wenn auch nicht immer und nicht ausschließlich und in unterschiedlichen Graden. Bekanntlich hat sich die Moderne von dieser äußeren Referenz gelöst und auf das künstlerische Material – Farben, Formen, Klänge etc. – als dem eigentlichen Thema der Kunst bestanden. Damit hat sie sich jedoch nicht grundsätzlich von den Sinnen abgewendet, sondern – häufig genug – noch stärker zugewendet; gleichwohl unterstützt oder auch dominiert von einer geradezu wuchernden Theoriebildung. Erst in dieser Epoche – der Moderne – entsteht durch die Arbeit der künstlerischen Avantgarden das, was wir heute visuelle Kommunikation nennen.
Sieht man sich weiter um, wird man feststellen, dass sämtliche Medien resp. Künste in irgendeiner Hinsicht defizitär sind: fangen wir noch mal beim Bild an: ihm fehlen nicht nur räumliche Tiefe und Bewegung, sondern auch der Ton; der Film verfügt zwar über Bewegung, Klang und Sprache, die Tiefendimension fehlt aber ebenso wie beim statischen Bild; der Musik wiederum fehlt das Sichtbare, allen gemeinsam ist der Mangel sowohl haptischer wie olfaktorischer Qualitäten.
Wendet sich die Sprache ans Gehör, ohne jedoch mit dem, wovon sie berichtet, irgendeine Ähnlichkeit zu besitzen (ausgenommen die Onomatopoesie), so kann die Literatur überhaupt keine sinnliche Dimension vorweisen, mit Ausnahme der Schriftgestaltung, also der Typographie, die man allerdings in den meisten Fällen nicht unter die Bilder zählen kann.3 Und doch ist es der Sprache eigentümlich, alle Sinneseindrücke repräsentieren zu können, während Bilder im Wesentlichen nur Sichtbares repräsentieren können und die Musik nur Akustisches.
So führt die Suche nach dem idealen Medium scheinbar automatisch zum Tanz und zum Theater, wo endlich alle Sinne vereint angesprochen werden, auch wenn selbst hier noch das haptische Erlebnis über das Visuelle erschlossen werden muss. Allerdings deckt sich dies mit unserer Alltagserfahrung, denn die meisten Dinge betrachten wir aus einem gewissen Abstand; so können wir sie zwar nicht berühren, sie können uns aber auch nicht gefährlich werden. Die gustatorische Ebene darf wohl insgesamt vernachlässigt werden, denn die Menge derer, die ein Kunstwerk essen wollen, ist, der Zahl der Werke nach zu urteilen, die sich damit befassen, eher gering. Zudem ist der Geschmacksinn wesentlich mit der Nahrungsaufnahme verbunden und muss daher, lässt man das Phänomen der synästhetischen Wahrnehmung unberücksichtigt, bei der mitunter Farbeindrücke gleichzeitig ein Geschmackserlebnis hervorrufen können, als Sonderfall gewertet werden.
Nun widerspricht die Annahme, es handele sich bei Tanz und Theater um die bestmöglichen, weil aufs engste mit der Wirklichkeit verbundenen Medien, der Erfahrung, dass diese einen deutlich geringeren Anteil am sowohl massenmedialen wie künstlerischen Geschehen haben, als Bilder, Literatur oder Musik. Müssten wir es nicht überall und bei jedweder Gelegenheit einer kommunikativen und ästhetischen Situation mit dem Tanz und dem Theater zu tun haben? Wie wir gesehen haben, sind beide, Tanz und Theater, auf der Rezeptionsebene nicht mit den Vorzügen von Bildern, seien diese statisch oder bewegt, ausgestattet und sind aus diesem bedeutenden Grund dem Bild auch nicht vorzuziehen, ganz gleich, was ihre Ausdrucksmöglichkeiten sind.
Nur Musik und Literatur können hinsichtlich medientechnischer Faktoren der Rezeption wie Reproduzierbarkeit und Mobilität, mit dem Bild gleichziehen, und es sind Bild, Musik und Text, denen die größte massenmediale Bedeutung zukommt. Sieht man einmal von Verfahren wie Keramikguss oder Metalguss ab, die bereits in der Stein- bzw. Bronzezeit entwickelt wurden, so gelang es zuerst im 9. Jahrhundert mit der Erfindung des Holzschnitts in China und danach mit dem von Johannes Gutenberg erfundenen Buchdruck mit beweglichen Lettern, in der Mitte des 15. Jahrhunderts, Texte auf mechanische Weise zu vervielfältigen. Erst sehr viel später, am Ende des 18. Jahrhunderts, wurde mit der Lithographie ein Verfahren entwickelt, das die Reproduktion von Bildern in großen Auflagen ermöglichte und aus dem der moderne Offsetdruck hervorging. Erst im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts konnte man mittels Phonograph Musik und Sprache aufzeichnen, konservieren und reproduzieren.
Leonardos leidenschaftliches Engagement für die Malerei als bedeutendste Kunst
Werfen wir einen Blick in die Geschichte, um zu sehen, was in früheren Zeiten mit dem Thema, das uns hier beschäftigt, gesagt wurde. Als Quelle dient dazu Leonardo da Vincis (1452–1519) berühmter Traktat von der Malerei (1498)4. Die Tatsache, dass die verschiedenen Künste vornehmlich mit nur einem und nicht mit mehreren oder gar allen Sinnen gleichzeitig korrespondieren, folglich ein jeweils eigenes Ausdrucksspektrum besitzen sowie mit diversen Hürden bei der Repräsentation der äußeren Wirklichkeit zu kämpfen haben, gab in der Renaissance Anlass zum sogenannten Paragone. Im Wettstreit der Künste sollte sich erweisen, welche die beste sei, und Leonardo argumentiert in seinem Traktat von der Malerei für die Überlegenheit der Malerei über Poesie, Bildhauerei und Musik. Der Traktat ist ein kunst- und medientheoretischer Aufsatz mit polemischem Einschlag, kein wissenschaftlicher Text – auch wenn es dem Autor u. a. darauf ankommt, die Malerei als Wissenschaft zu verteidigen. Dennoch enthält er eine ganze Reihe wichtiger Beobachtungen und Argumente – von denen zwar einige im Laufe der Zeit an Bedeutung verloren haben, andere jedoch nicht –, die es sich lohnt genauer anzusehen. Sämtliche Überlegungen orientieren sich an der Natur als Voraussetzung – d. h. der äußeren Wirklichkeit, wie wir es hier ja bisher auch getan haben. An der Natur müssen sich die Künste messen lassen, weil es ihre Aufgabe ist, die Welt nachzuahmen, und zwar jede nach ihren Kräften, wie es in dem nebenstehenden Zitat heißt. Leonardo untersucht, was diese Kräfte jeweils vermögen.
Die Hierarchie der Künste ermittelt Leonardo zunächst aus dem Rang der Sinne. Weil wir durch das Sehen in der Lage sind, die Natur, die Gottes Werk ist, zu erkennen, bezieht dieses eine herausragende Position gegenüber den anderen Sinnen. »[W]er das Gesicht verliert, ist wie ein aus der Welt Ausgetriebener; denn er sieht sie nicht mehr, noch irgend eines ihrer Dinge, und solch ein Leben ist eine Schwester des Todes.« (da Vinci, 1909, S. 12) Sehen ist, wie bereits zu Beginn des einleitenden Textes erwähnt, gleichbedeutend damit zu leben. Wer nicht sieht, ist praktisch nicht lebensfähig, und vor die Wahl gestellt, entweder das Augenlicht oder den Hörsinn zu verlieren, würde niemand, so Leonardo, sich für Blindheit entscheiden. »Es gibt kein so sinnbetörtes Urteil, das, wenn ihm die Wahl vorgelegt würde, entweder in ewiger Finsternis zu verharren, oder das Gehör zu verlieren, nicht augenblicks sagte, es wolle lieber das Gehör mitsamt dem Geruch verlieren, ehe es blind sein müßte. Denn wer das Gesicht verliert, verliert die Schönheit der Welt mitsamt allen Formen der geschaffenen Dinge, und der Taube geht bloß des Tones verlustig, […], und das ist doch in der Welt etwas sehr Geringfügiges.« (da Vinci, 1909, S. 28) Weil die Malerei dem Auge dient, ist sie naturgemäß bedeutender als die Poesie, die sich an den niedrigeren Sinn des Ohres wendet. Wie alle seine Argumente taucht auch dieses, bei wechselnder Wortwahl, über mehrere Abschnitte verteilt immer wieder auf.
Kerngedanke der Auseinandersetzung ist, wie gesagt, die Aufgabe und Eignung der Künste zur Nachahmung der Welt. Diese in der Antike entwickelte Auffassung darf bis heute als das wohl erfolgreichste Konzept gelten. Weil »das Auge die Schönheit der ganzen Welt umfaßt« (da Vinci, 1909, S. 29), gehört die Welt auch der Malerei, welche »einzig Nachahmerin aller sichtbaren Naturwerke« (da Vinci, 1909, S. 10) ist. Hingegen ahmt die Poesie nur die Menschen nach, und, streng genommen, erstreckt sich ihr Gebiet nur über die menschliche Sprache, sofern sie gesprochen wird. Denn Werke beispielsweise der Wissenschaft, sind keine der Poesie, sondern eben der Wissenschaft, mögen sie auch sprachlich verfasst sein. Somit verfügt die Sprache nur über einen sehr kleinen originären Bereich und ist allein deswegen der Malerei, die alles Sichtbare umfasst, unterlegen.
»Eine Malerei ist ein stummes Gedicht, und ein Gedicht eine blinde Malerei, und die eine wie das andere geht darauf aus, die Natur nachzuahmen, soweit es in ihren Kräften liegt.«
Leonardo da Vinci5
Der offensichtlichste Unterschied zwischen Bild und Sprache besteht in den Mitteln der Repräsentation. Basiert die Beziehung zwischen dem Dargestellten und der Darstellung in der Malerei auf Ähnlichkeit, so bezeichnet man das Verhältnis bei der Sprache als arbiträr, also durch Konvention oder Übereinkunft festgelegt. Wird man einen Tisch malen wollen, so geben der Gegenstand und die Wahrnehmung vor, wie dieser notwendigerweise darzustellen ist. Man kann nicht einfach ein paar bliebige Linien und Flächen auf die Leinwand werfen, da nur eine bestimmte Anordnung dem Anblick eines Tisches entspricht. Es ist hingegen etwas völlig anderes, einen Tisch sprachlich zu bezeichnen, wie man ja am Wort ›Tisch‹ erkennt, für das es keine Notwendigkeit gibt und das in den verschiedenen Sprachen auch jeweils ein anderes ist.
Diese zeichentheoretische Grundlage, also die Beziehung zwischen Darstellung und Dargestelltem, gibt Leonardo eine Reihe von Gründen an die Hand, weshalb die Poesie die geringere Kunst sei. Nicht nur, dass die Malerei (weil sie die Welt durch Ähnlichkeit nachahmt) alle Dinge auf einmal und mit allen Details vor uns hinzustellen vermag, wie es dem Anblick der Natur entspricht, während die Poesie alles nur nacheinander wiedergeben kann und enorme Zeit dafür benötigt. Es bleibt der ganze Aufwand auch noch hinter dem angestrebten Ziel zurück, da der Hörer (oder die Leserin) nicht dieselbe Vorstellung gewinnt, wie bei einem Bild. Er verdeutlicht dies an einem Beispiel:
»Wirst du Dichter die blutige Schlacht darstellen, steht man da vor düsterer Luft, verdunkelt von der erschrecklichen Mordmaschinen Dampf, der sich mit dichtem, den Himmel trüb einhüllendem Staube mischt, und inmitten der Flucht Elender, vom furchtbaren Tod Gescheuchter? In solchem Falle überragt dich der Maler; denn deine Feder wird aufgebraucht sein, ehe daß du vollauf beschreibst, was der Maler dir, mit seiner Wissenschaft, unmittelbar vor Augen stellt. Und es wird deine Zunge vom Durst, der Körper vom Schlaf und Hunger gehemmt werden, ehe du das in Worten darlegst, was dir der Maler in einem Augenblicke zeigt. In diesem Bild fehlt nichts als die lebendige Seele der vorgestellten Dinge, und an jedem Körper ist die ganze Seite völlig da, die sich in einer Ansicht zeigen kann, und das wäre eine langwierige und sehr ermüdende Sache für eine Dichtung, alle die Bewegungen derer herzusagen, die in solch einer Schlacht fechten, sowie die Teile der Gliedmaßen und ihren Schmuck, Dinge, welche das fertige Bild in großer Kürze und Wahrhaftigkeit vor dich hinstellt. Es geht dieser Darstellung nichts ab, als der Lärm der Geschütze, die Rufe der schreckeinflößenden Sieger und das Geschrei und Heulen der Geschreckten, Dinge, welche der Dichter gleichfalls dem Gehörsinn nicht darstellen kann.« (da Vinci, 1909, S. 14)
Die Malerei, bei der es sich nach Leonardos Überzeugung um eine Wissenschaft handelt, kann nahezu alles, und wo ihr etwas mangelt, steht die Poesie auch nicht besser, eher schlechter da: Zwar ist der Maler gezwungen jeweils nur eine Ansicht abzubilden, diese ist allerdings wahrhaftig und eben augenblicklich in allen Details präsent. Selbst wenn die Poesie versuchte, die Fülle der Einzelheiten wiederzugeben, wäre das Ergebnis ermüdend. Den Ton, das räumt er ein, hat die Malerei keine Mittel darzustellen – die Poesie aber auch nicht, sofern es sich um anderes als gesprochene Sprache handelt.
Aus der Ähnlichkeit leitet sich unmittelbar das große Spektrum der Malerei ab, von dem schon die Rede war; Leonardo verleiht dem Argument aber noch eine andere Wendung: »[D]enn der Maler wird unendlich viele Dinge machen, die Worte nicht nennen können, weil der für sie geeignete Ausdruck fehlt. Siehst du denn nicht ein, wenn der Maler Getier oder Teufel in der Hölle vorstellen will, in welche überströmende Fülle der Erfindung er sich ergießt?« (da Vinci, 1909, S. 15) Nicht alles, was sichtbar ist, ist auch sagbar, für manche Erscheinungen fehlen schlicht die passenden Worte. Darüber hinaus triumphiert die Malerei auch auf dem Gebiet der Fantasie. Einer im Bild vor Augen gestellten Erfindung eignet größere Wahrhaftigkeit, weil mittels Perspektive und Licht eine Realitätsnähe erreicht wird, die der Sprache versagt bleibt. Das in der nebenstehenden Abbildung gezeigte Gemälde von Pieter Bruegel d. Ä. (1525–1569) illustriert gut, woran der Meister hier vermutlich dachte.
Während die Malerei in ihren, wie Leonardo sie nennt, »Scheinbildern«, die Dinge »nicht anders [zeigt], als wenn dieselben von der natürlichen Wirklichkeit herrührende wären« (da Vinci, 1909, S. 13), sie also die Sprache der Natur spricht, die jeder intuitiv versteht, haben die Dichter »nichts als die Namen, die nicht allgemein verständlich« (da Vinci, 1909, S. 18) und von den Dingen weit entfernt, d. h. diesen unähnlich sind. Auch ästhetisch zieht das Bild an der Poesie vorbei, denn Aufgrund der Gleichzeitigkeit des Dargestellten ist die Malerei zur höchsten Harmonie befähigt. Denn »alles, was es im Weltall gibt, sei es nun in Wesenheit und Dasein, oder in der Einbildung, er [der Maler, A.R.] hat es, zuerst im Geist und dann in den Händen, und die sind von solcher Vorzüglichkeit, daß sie eine gleichzeitige, in einen einzigen An- und Augenblick zusammengedrängte Verhältnisharmonie hervorbringen, wie die (wirklichen, sichtbaren) Dinge tun.« (da Vinci, 1909, S. 15) Harmonie gibt es nur zwischen verschiedenen Dingen, die sich der Wahrnehmung gleichzeitig präsentieren. Umgekehrt bedeutet dies, weil in der Poesie »die Teile getrennt und in getrennten Zeitabschnitten ausgesprochen werden, so empfängt das Gedächtnis keinerlei Zusammenklang«. (da Vinci, 1909, S. 21) Das Nacheinander der sprachlichen Zeichen steht der Harmoniebildung im Wege. Offensichtlich dient die dem Gedächtnis unterstellte Unfähigkeit, zeitlich getrennte Dinge nicht in ein Verhältnis setzen zu können, nur zur wiederholten Herabsetzung der Poesie. Zwar ist nicht abzustreiten, dass, besonders mit zunehmender Länge, die Anforderung an das Publikum steigt, die aufeinanderfolgenden Elemente in ein Ganzes zu synthetisieren, doch wie wäre der Erfolg zeitbasierter Medien – Literatur, Musik, Film – zu erklären, würde das Publikum tatsächlich nur Stückwerk wahrnehmen?
Aufgrund der Ähnlichkeit besitzen Bilder zudem ein größeres Erregungspotential. »Durch sie werden Liebende bewegt, dem Bildnis des geliebten Gegenstandes zugewandt, zu nachgeahmten Malereien zu reden; durch sie werden die Völker erregt, mit heißen Gelübden die Bilder der Götter aufzusuchen; das tut kein Erblicken von Werken der Dichter, die etwa die nämlichen Götter mit Worten vorstellen.« (da Vinci, 1909, S. 17) Nicht zu vergessen die erotisierende Wirkung körperlicher Nacktheit im Bilde: »Man wähle einen Dichter, daß er eines Weibes Reize deren Liebhaber beschreibe, und dann nehme man einen Maler, daß er es darstelle; man wird gewahr werden, wohin Natur den liebenden Richter mehr hinzieht.« (da Vinci, 1909, S. 18) Ständig laufen Betrachter Gefahr, Bild und Wirklichkeit zu verwechseln: »Und der Maler überwältigt die Geister der Menschen in dem Grade mehr, daß er sie dazu verleitet, ein Bild zu lieben und sich in dasselbe zu verlieben, das gar kein lebendiges Weib vorstellt.« (da Vinci, 1909, S. 26)
Auch den Wettstreit mit der Bildhauerei kann die Malerei für sich entscheiden. War es noch die naturgetreue Nachahmung, die die Malerei vor der Poesie auszeichnete, so wird gerade dies der Skulptur als Schwäche ausgelegt: ihre Dreidimensionalität ist ohne Witz, denn sie »zeigt dem Auge was da ist, wie es ist; sie verursacht ihrem Betrachter nicht die mindeste Verwunderung, wie die Malerei tut, die auf einer ebenen Fläche kraft ihrer Wissenschaft weitausgedehnte Gefilde mit fernen Horizonten zeigt.« (da Vinci, 1909, S. 34) Nicht darf die Zweidimensionalität der Malerei als Nachteil angesehen werden, tatsächlich verdankt sich ihr ganzer Zauber der Kunst des Scheins! »O wunderbare Sache, Ungreifbares greifbar aussehen zu lassen, Flaches erhaben, etwas Nahes entfernt! In der Tat, die Malerei ist mit unzähligen Künsten der Spekulation und mit zahllosen Fällen der Schau geschmückt, welche die Skulptur nicht ins Werk setzt.« (da Vinci, 1909, S. 40) Darüber, dass man eine Skulptur von allen Seiten betrachten kann, die der Bildhauer bei seiner Arbeit mitdenken muss, verliert der Meister kein Wort. Wie auch immer, in dem was er als die »unzähligen Künste der Spekulation« bezeichnet, ist wohl wichtigste Aussage getroffen. So sehr Leonardo Naturnähe als Ausweis höchster künstlerischer Leistung begreift, so doch nur, wenn der Maler diese durch den Zauber des Scheins aus der Fläche hervorbringt. Voraussetzung ist, dass der Maler die Gesetze der Natur durchschaut hat; Malerei ist im Grunde Naturbeherrschung. Eine Skulptur, die nichtgreifbar aussieht, sondern tatsächlich greifbar ist, mag deswegen eine größere Naturnähe besitzen, jedoch schätzt Leonardo den Anteil des Künstlers daran als gering ein. Wo die Zeichen der Poesie von der Natur zu weit entfernt sind, haben jene der Bildhauerei zu wenig Distanz, dazwischen befindet sich die Malerei, deren Verhältnis zur Welt vom Schein bestimmt wird, dem sie ihre Einzigartigkeit verdankt. Dem Meister kommt es offenbar gar nicht in den Sinn, dass die mangelnde räumliche Tiefe der Malerei zum Nachteil gereichen könnte. Malerei überzeugt, ja bezaubert durch Täuschung, durch List und gerade deswegen verblassen alle anderen Künste neben ihr.
Gegenüber den hohen geistigen Anforderungen der Malerei steht die Bildhauerei als grobes und schmutziges Handwerk, sie ist kaum mehr als ein »mechanisches Geschäft und ist oft von großem Schweiß begleitet, der, mit Staub vermengt, zu Schlamm wird. Da hat er das Gesicht ganz beschmiert und mit Marmorstaub eingepudert, so daß er wie ein Bäcker ausschaut, und ist mit kleinen Marmorsplittern über und über bedeckt, daß es aussieht, als hätte es ihm auf den Buckel geschneit, und seine Behausung, die ist voll Steinsplitter und Staub.« (da Vinci, 1909, S. 35) Dagegen sitzt der kultivierte und vornehme Maler »mit großer Bequemlichkeit vor seinem Werk, wohl gekleidet, und regt den ganz leichten Pinsel mit den anmutigen Farben. […] Und seine Behausung, die ist voll heiterer Malereien und glänzend reinlich.« (da Vinci, 1909, S. 35)
Wo der Bildhauer sich auf die Natur verlässt, die seine Werke wie alle anderen Dinge beleuchtet, übernimmt der Maler »Kraft seines Geistes« (da Vinci, 1909, S. 41) deren Aufgaben selbst, »das sind die beiden Perspektiven, und auch noch ein drittes von großer Wichtigkeit und Überlegung, nämlich das Helldunkel der Schatten und Lichter, von dem der Bildhauer nichts weiß, und hinsichtlich dessen ihm von der Natur ebenso ausgeholfen wird«. (da Vinci, 1909, S. 38) Weiters sind dem Bildhauer durch sein Material Grenzen gesetzt, die die Malerei nicht kennt. »Die Bildhauer können weder durchsichtige noch leuchtende Körper darstellen, nicht Reflexstrahlen und nicht blanke Körper, wie Spiegel und andere dergleichen glänzende Dinge, keine Nebel, kein dunkles Wetter und so zahllose Sachen nicht, die wir nicht nennen, um nicht zu ermüden.« (da Vinci, 1909, S. 39)
Das Fazit fällt vernichtend aus: »Wie die Malerei schöner und von mehr Phantasie und reichhaltiger ist, so ist die Bildhauerei dauerhafter. Etwas anderes hat sie nicht voraus.« (da Vinci, 1909, S. 40) Dieser einzige Vorzug relativiert sich noch mehr, wenn man bedenkt, dass die Bildhauerei nicht einmal selbst dafür verantwortlich ist, da die Natur die Materialien bereits vorhält.
Abschließend sei noch angemerkt, dass Leonardo die Malerei, weil sie eine Wissenschaft ist, für die geistigste der Künste hält. Weiterhin zeichnet sie aus, dass sie nicht erlernbar ist, man benötigt Talent, und davon am besten reichlich. Außerdem sind ihre Werke einzigartig, sie lassen sich nicht wie Texte mittels Druckverfahren vervielfältigen, und man kann auch keinen Abguss anfertigen, sodass ein zweites und jedes weitere Exemplar dem ersten genau gleicht. Die Renaissance kannte weder Lithografie bzw. Offsetdruck noch Fotografie. Beide Technologien haben so manchem Argument, das im 15. Jahrhundert noch Gültigkeit besaß, die Grundlage entzogen. Mit Erfindung der Fotografie wurden die geistigen Anstrengungen des Malers entwertet – zumindest in Bezug auf das Ziel der Naturnähe – und der Druck hat, wie der deutsche Philosoph Walter Benjamin (1892–1940) in seinem berühmten Kunstwerk-Aufsatz 6 gezeigt hat, die Aura der Einmaligkeit zerstört. Und spätestens seit Einführung K.I.-basierter Bildgeneratoren sind auch malerisch völlig unbegabte Menschen in der Lage, fotorealistische Bilder zu produzieren, die wie Malerei aussehen.
Eine Idee hat die Zeiten jedoch fast unbeschadet überstanden. Ist das Ziel der höchsten Wirklichkeitstreue auch für die Kunst (fast) kein Thema mehr, so hängt daran doch eine milliardenschwere Unterhaltungsindustrie. Maximaler Realismus – bis zum Hyperrealismus gesteigert – ist für Computer Games und Virtual Reality zugleich ästhetische Norm und Verkaufsargument.
© Andreas Rauth, 2024
Anmerkungen
- Rudolf Arnheim (1977), Anschauliches Denken. Zur Einheit von Bild und Begriff [1969], DuMont, S. 25.
- Hans Jonas, Homo Pictor: Von der Freiheit des Bildens, in: Gottfried Boehm (Hg. 1994), Was ist ein Bild?, Wilhelm Fink, S. 105–124
- Es gibt eine ganze Reihe interessanter Fälle, die den Ort zwischen Schrift und Bild besetzen, dazu gehören die mittelalterlichen Initialen, die Kalligraphie oder etwa einzelne Seiten von Will Eisners (1917–2005) Comicserie The Spirit (1940–1952) u.v.m.
- Leonardo da Vinci (1909), Traktat von der Malerei [1498]. Nach der Übersetzung von Heinrich Ludwig, neu herausgegeben und eingeleitet von Marie Herzfeld, Eugen Diederichs. Ein im open access verfügbares Digitalisat findet man bei archive.org
- da Vinci, 1909, S. 20.
- Walter Benjamin (2022), Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (1936), Suhrkamp.